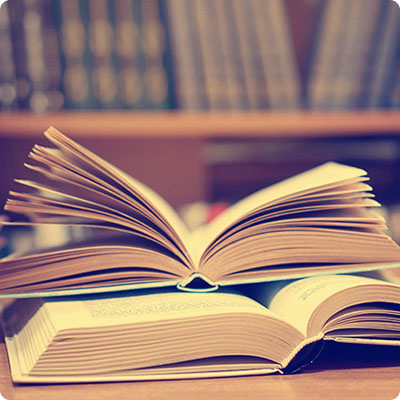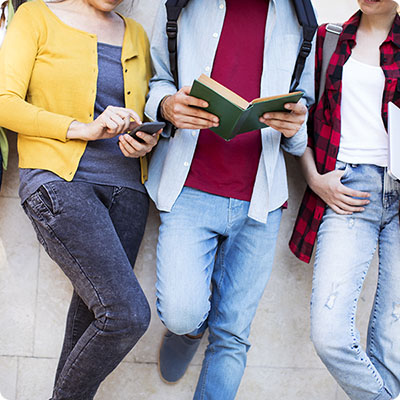Schicksale
Wie Höhlenmalereien belegen, ist Borneo seit mehreren zehntausend Jahren bewohnt. Diese schwindelerregende Zahl wird durch die ersten chinesischen Texte untermauert, die die Insel erwähnen und sie bereits im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung als Handelsposten bezeichnen. Der Handel war ein Knotenpunkt, an dem sich Zivilisationen kreuzten, austauschten und vermischten. Dann folgten die Machtspiele der europäischen Mächte, die versuchten, das Gebiet zu übernehmen, und neue Einflüsse und Sprachen mitbrachten. Heute bestätigt die besondere Lage Borneos - drei Länder teilen sich das Land -, dass die Vermischung der Bevölkerungsgruppen immer noch aktuell ist. Die Literatur ihrerseits hat von diesen Mischungen profitiert, zunächst in ihrer lebendigsten Form - die leider auch die flüchtigste ist - der mündlichen Überlieferung. Der Name Mady Villard ist heute vielleicht etwas in Vergessenheit geraten, doch sie hatte ihre französischen Mitbürger beeindruckt, als sie 1975 in Borneo, chez les hommes aux longues oreilles (Borneo, chez les hommes aux longues oreilles) erzählte, wie sie in einem Stamm tief im Dschungel gelebt hatte. Dieser Titel ist inzwischen vergriffen, aber dank Mady Villard - und Magali Tardivel-Lacombe, die sie bei dieser Arbeit begleitete - können wir ein bisher gut gehütetes Geheimnis entdecken: die Märchen und Legenden von Borneo, die ihr die Ältesten aus mehreren Völkern - Kelabits, Kadazans, Muruts und Punans - anvertraut hatten und die der Flies-Verlag 2013 in seiner Reihe Aux origines du monde veröffentlichte. Mit Genuss, Zärtlichkeit und - warum nicht - einigen Schauern wird man die 34 Erzählungen entdecken, in denen sich der Drache des Mount Kinabalu, ein Krokodil ... und menschenfressende Geister bewegen.
Das Leben von James Brooke war so abenteuerlich, dass der berühmte britische Anthropologe Nigel Barley ihm eine Biografie widmete, die unter dem Titel Un rajah blanc à Bornéo bei Payot auf Französisch erschienen ist. Wie sein Name schon sagt, hatte der "Sir" einen englischen Vater, der damals Verwalter der Ostindien-Kompanie war, und so war Benares am 29. April 1803 Zeuge seiner Geburt. Im Alter von 32 Jahren kaufte er sich ein Schiff und machte sich auf den Weg nach Kuching, der Hauptstadt von Sarawak, die sich damals in einem Konflikt mit Brunei befand. Brooke betätigte sich als Moderator und erlangte den Status eines "Rajah" und internationalen Ruhm. Nach seinem Tod im Jahr 1868 erbte sein Neffe Charles Anthony Johnson Brooke seinen Status als "Vizekönig" von Sarawak, doch es war seine Frau Margaret, die sich mit ihren Memoiren, die 2022 vom Verlag Magellan & Cie auf Französisch neu aufgelegt wurden, einen guten Ruf erwarb. In diesem Buch - Königin in Borneo: Erinnerungen an ein einzigartiges Leben (1849-1936) - erzählt die "Lady", die zur "Rani" wurde, freimütig von ihrem Alltag, der weit von ihrer Kindheit in Paris entfernt war, aber nahtlos zwischen der guten viktorianischen Gesellschaft und der malaysischen Gemeinschaft, in der sie Freundschaften geschlossen hatte, hin und her schwankte. Ebenfalls mit 20 Jahren landete der in Dänemark geborene Carl Bock (1849-1932) auf Borneo und wurde vom Generalgouverneur von Niederländisch-Ostindien beauftragt, das Landesinnere des Südostens zu erforschen. Sein Bericht - erstmals 1881 veröffentlicht und später überarbeitet - war ein großer Erfolg ... trug aber auch dazu bei, der Insel ein etwas schwülstiges Image zu verleihen, wie der bewusst griffige Titel vermuten lässt: Headhunters ofBorneo (Bei den Kannibalen von Borneo, Verlag der BNF).
Abenteuer
Weniger sensationslüstern, sondern eher mit der Feder vertraut, sind zwei Schriftsteller, die sich mit Borneo beschäftigen und ihre eigene Sicht auf die Insel schildern: Joseph Conrad (1857-1924), der um 1887 mindestens viermal dort anlegte, und Somerset Maugham (1874-1965), der in den 1920er Jahren viel reiste, vor allem nach Asien. Von dem einen muss man seinen ersten Roman, La Folie Almayer (éditions Autrement), lesen, der die Insel als Schauplatz und einen alternden Mann als Antihelden nimmt, von dem anderen seine Novellen, darunter mindestens Der mal aiische Zauber, in dem ein irischer Pflanzer an dem Fluch stirbt, den seine malaiische Frau auf ihn gelegt hat, nachdem sie von ihm verlassen worden war. Nach diesen Fiktionen - denen man anmerkt, dass sie von der besonderen Atmosphäre Borneos beeinflusst sind - beginnt der Reigen der Wissenschaftler, Forscher und Journalisten. Zu nennen wären hier der schwedische Ethnologe Eric Mjöberg, der von 1922 bis 1924 Kurator des staatlichen Museums von Surawak war und 1938 an einer seltsamen Krankheit starb, bei der er von den Geistern heimgesucht wurde, die er in Australien studiert hatte, oder der Brite Owen Rutter, dessen Schriften ebenfalls nicht in unsere Sprache übersetzt wurden(Pagans of North Borneo, 1929). Was ihre weiblichen Kollegen betrifft, so ist es unmöglich, nicht an Élisabeth Sauvy zu denken, die besser unter ihrem Pseudonym Titaÿna bekannt ist. Die 1897 in Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) geborene Journalistin war eine der ersten, die sich in der Zwischenkriegszeit dank ihrer ausgedehnten Reisen und unerschrockenen Abenteuer den Titel einer großen Reporterin verdiente. Die zweite Hälfte ihres Lebens war weniger ruhmreich, denn sie wurde wegen Kollaboration verurteilt und geriet in San Francisco in Verruf und Vergessenheit, wo sie 1966 starb und vielleicht Selbstmord beging. Der Marchialy-Verlag hat jedoch beschlossen, ihre Langzeitreportagen neu zu veröffentlichen, darunter auch Eine Frau bei den Kopfjägern, die nicht in Borneo spielt, wo sie jedoch recherchiert hat, sondern bei den Toraja in Süd-Sulawesi, einer Provinz in Indonesien, die nur einen Steinwurf entfernt liegt.
Agnes Newton Keith (1901-1982) hatte ebenfalls ein ungewöhnliches Leben. Nachdem sie ihre Karriere als Journalistin nach einem schrecklichen Überfall abgebrochen hatte, verließ sie ihre Heimat Amerika, um ihrem Mann, einem Forstverwalter in Nordborneo, zu folgen. Ihre ersten fünf Jahre in Sandakan waren idyllisch und inspirierten sie zu Land Below the Wind, das zunächst in Fortsetzungen erschien und später in einem Sammelband veröffentlicht wurde. Leider brach der Krieg aus und 1942 landeten die Japaner, das Paradies wurde zur Hölle und Agnes wurde mit ihren Verwandten in einem Lager eingesperrt, aus dem sie erst 1945 befreit wurden. Das Tagebuch, das sie heimlich führte, diente ihr später als Grundlage für die autobiografische Erzählung Three Came Home, die später verfilmt wurde. Ihre Borneo-Trilogie wurde mit White Man Returns abgeschlossen, aber leider wurde keiner dieser drei Titel ins Deutsche übersetzt. Wer sich hingegen für diese Zeit interessieren möchte, kann versuchen, sich Le Dernier des derniers: la vie extraordinaire de l'anthropologue anglais Tom Harrisson von Judith M. Heimann (Octares Verlag, 2005), eine Biografie über einen Wissenschaftler, der den größten Teil seines Lebens in Sarawak verbrachte, oder diese drei Titel auf dem Gebrauchtmarkt suchen : Un Royaume en or von Vitold de Golish (Flammarion, 1970), Un Étranger dans la forêt: jusqu'au bout des mystères de Bornéo von Eric Hansen (Albin Michel, 1990) und Au cœur de Bornéo von Redmond O'Hanlon (Payot, 2001).
Verpflichtungen
Mit dem Wandel der Zeit verändert sich auch die Abenteuerliteratur, wie alle anderen Literaturen. Wade Davis, ein 1953 in Kanada geborener Anthropologe, schrieb das bislang unübersetzte Buch Penan Voice of the Borneo, und er ist auch der Autor von Unsere Welt braucht die Weisheit der Vorfahren, ein Buch, das seine Philosophie und seine Sorgen gut erklärt und im Verlag Albin Michel zu finden ist. Der um ein Jahr jüngere Bruno Manser wurde in Basel geboren und gilt seit 2000 als vermisst. Mit 30 Jahren verließ er seine Schweizer Heimat und ging nach Borneo. Er träumte davon, sich in das Nomadenvolk der Penan zu integrieren, denn er war Hirte geworden und nicht Arzt, wie seine Eltern es sich gewünscht hätten. Er dokumentierte ausführlich seine Erfahrungen mit der Rückkehr zur Natur und war bald alarmiert über die Entwaldung, die sowohl die Tierwelt als auch die Lebensweise seiner Vorfahren bedrohte und die Gemeinschaft, die ihn aufgenommen hatte, zur Rebellion veranlasste. Sein Buch - Stimmen des Regenwaldes: Zeugnisse eines bedrohten Volkes - ist seit langem vergriffen, aber eine Biografie von Ruedi Suter , Bruno Manser: Die Stimme des Waldes, wurde 2020 bei Black-star (s)éditions veröffentlicht. Eine zweite, von Carl Hoffman verfasste Biografie wurde bislang nicht übersetzt. Sie trägt den Titel The Last Wild Men of Borneo: A True Story of Death and Treasure und erwähnt im Übrigen Michael Palmieri, einen Spezialisten für Stammeskunst, der ebenfalls eine Leidenschaft für die Insel hegt - allerdings aus anderen Gründen. Aurélien Brulé, 1979 im Departement Var geboren, hat als Pseudonym den Namen der Tierart angenommen, der er sein Leben gewidmet hat: dem Gibbon, Chanee in der thailändischen Sprache. Er ist Gründer der Organisation Kalaweit, die auf Borneo und Sumatra tätig ist, und hat ein knappes Dutzend Bücher veröffentlicht, darunter Borneo: au nom de la vie und Hâte d'être à demain pour continuer à sauver... (Presses du Midi).
Abschließend sei noch erwähnt, dass Robert Raymer einer der wenigen Schriftsteller ist, die Fiktion verwenden, um uns einen Einblick in die heutige Realität auf der Insel zu geben, auf die er aus den USA ausgewandert ist. Seine Kurzgeschichtensammlung Drei andere Malaysias wurde 2011 vom Globe-Verlag ins Deutsche übersetzt und lebt heute in Sarawak. Auch diese Stimme, die an Borneo erinnert, ist keine Einheimische, denn Autoren, die eine direkte Verbindung zu der Insel mit den drei Ländern haben, sind auf Französisch rar oder gar nicht vorhanden.
Die Liste der Preisträger des SEA Write Award, des südostasiatischen Literaturpreises, bietet uns die Möglichkeit, Schriftsteller zu entdecken, die mit Brunei verbunden sind, auch wenn ihre Werke uns fern bleiben: Jamil Al-Sufri (1921-2021), Yahya bin Ibrahim (1939-2022), Muslim bin Burut (1943-2021) und Hajah Norsiah binti Haji Abdul Gapar, Preisträgerin 2009, Jahrgang 1952. Wir könnten auch Chang Kuei-hsing erwähnen, der 1956 in Sarawak geboren wurde, aber offenbar die taiwanesische Staatsbürgerschaft annahm, nachdem er mit 20 Jahren zu Studienzwecken nach Taiwan gezogen war. Seine Bücher spielen auf seinen beiden Inseln, der Geburts- und der Adoptionsinsel, und sind der Strömung des magischen Realismus zuzuordnen. Sie stellen oft Tiere als würdige Vertreter ihrer menschlichen Vettern dar und beschäftigen sich auch mit ökologischen Themen. Die verschiedenen Preise, die er erhalten hat, lassen hoffen, dass wir eines Tages das Vergnügen haben werden, Herd of Elephants, Monkey Cup oder When Wild Boars Cross the River in unserer Sprache zu sehen. Chang Kuei-hsing vergisst nie, dass er aus der chinesischen Gemeinschaft stammt, was ihn mit zwei Schriftstellern aus der Nähe von Kuala Lumpur verbindet: Shih-Li Kow und Tan Twan Eng, die beide auf Englisch schreiben. Erstere hat ihre Porträtkunst verfeinert und zeichnet anhand ihrer Figuren das Bild einer multikulturellen Gesellschaft, sie ist bei Zulma mit La Somme de nos folies zu entdecken, das 2018 den Preis für den ersten ausländischen Roman erhielt. Die zweite widmet sich eher dem Spionageroman, insbesondere mit Le Jardin des brumes du soir und Le Don de la pluie, die bei Flammarion einen schönen Erfolg hatten. Tash Aw schließlich, der in Kuala Lumpur aufwuchs, wurde mit Der berüchtigte Johnny Lim (10-18) für den Booker Prize nominiert und verfolgt eine erfolgreiche literarische Karriere mit Die Karte der unsichtbaren Welt (10-18), Ein Fünf-Sterne-Milliardär (Robert Laffont), dann Wir, die Überlebenden und Ausländer auf dem Streik im Katalog von Fayard. Alle drei sind Kosmopoliten, die viel gereist sind und oft weit entfernt von der Hauptstadt Malaysias wohnten, wie Tash Aw, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, nach Frankreich zu kommen und dort zu schreiben.