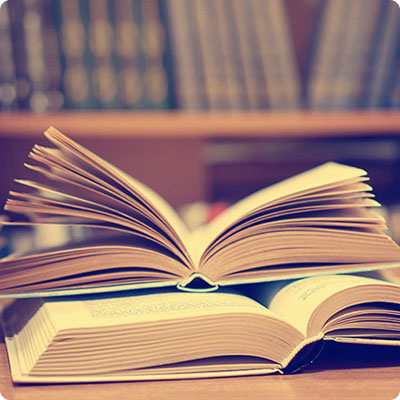Ein Blick auf das politische System
Norwegen ist eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Tendenz, die ihre Verfassung am 17. Mai 1814 verabschiedet hat. Der König ernennt die Minister und den Ministerpräsidenten, aber die Regierung muss auch ein Vertrauensvotum des Parlaments erhalten. Obwohl der König keine politische Macht hat (er steht jedoch an der Spitze der norwegischen Kirche), erfreut sich die Königsfamilie großer Beliebtheit. Der derzeitige Monarch, König Harald V., bestieg den Thron nach dem Tod seines Vaters, Olav V., im Jahr 1991. Die Regierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und seinem Ministerteam. Das Parlament (Stortinget) ist die gesetzgebende Institution Norwegens mit einem Einkammersystem. Es hat seinen Sitz in Oslo und besteht aus 169 Mitgliedern, die alle vier Jahre nach dem Verhältniswahlrecht gewählt werden. Eva Kristin Hansen ist seit dem 9. Oktober 2021 Präsidentin des Parlaments. Die Judikative wird durch den Obersten Gerichtshof, Høyesterett, verkörpert. Jonas Gahr Støre von der Arbeiterpartei(Arbeiderpartiet) ist seit dem 14. Oktober 2021 Ministerpräsident (2025 wird er mit einer fragilen Mehrheit wiedergewählt).
Internationale Beziehungen
Norwegen ist Mitglied der NATO, der UNO und des Nordischen Rates (politische Zusammenarbeit zwischen Dänemark, Finnland, Schweden, Island und Norwegen). Der Vorsitzende der NATO, Jens Stoltenberg, ist übrigens der ehemalige norwegische Ministerpräsident. Sie leistet wichtige humanitäre Hilfe für Entwicklungsländer in Afrika und Asien. Norwegen gehört zwar nicht zur Europäischen Union, ist aber seit seiner Gründung im Jahr 1960 Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Was ist mit der Europäischen Union?
Nach zwei aufeinanderfolgenden Ablehnungen in den Jahren 1972 und 1994 hat das norwegische "Nein" die Annäherung an die EU-Länder nicht erleichtert. Die Regierungen haben zwar versucht, die Verbindungen zu den EU-Ländern aufrechtzuerhalten, doch die Frage eines möglichen Beitritts steht nicht mehr auf der Tagesordnung und wird häufig aus den Wahldebatten ausgeklammert.
Wahlen im September 2025
Jonas Gahr Støre von der Arbeiterpartei (Mitte-Links) gewann die Parlamentswahlen vom 8. September 2025 und sicherte sich eine zweite Amtszeit, nachdem er bereits seit 2021 die Regierung geführt hatte. Sein Mitte-Links-Block bildete eine knappe Mehrheit im Parlament (Storting) und übertraf die für eine Regierung erforderliche Schwelle von 85 Sitzen. Wie schon 2021 standen die Themen Klima, Umwelt und Öl im Mittelpunkt des Wahlkampfs. Støre unterstützt die Beibehaltung der Ölexploration, jedoch in einem gemäßigteren Rahmen, während einige Koalitionspartner und Parteien des linken Spektrums (insbesondere die Grünen, die extreme Linke und die Umweltpartei) einen schnelleren Verzicht auf neue Explorationsgenehmigungen und ehrgeizigere Emissionsreduktionen fordern. Auf internationaler Ebene behauptet Støre, an der Ausrichtung Norwegens an der NATO sowie an starken Verbindungen zur Europäischen Union festzuhalten, obwohl Norwegen kein EU-Mitglied, sondern Teil des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ist. Fragen der Energieregulierung im Zusammenhang mit EU-Richtlinien führten zu einer politischen Krise vor der Wahl, die dazu führte, dass sich die Zentrumspartei Anfang 2025 aus der Regierungskoalition zurückzog.
Die Finanzkrise von 2008
Norwegen blieb von der globalen Finanzkrise 2008 ziemlich verschont. Im Jahr 2009 war der Arbeitsmarkt geschwächt und die Regierung legte ein Hilfspaket in Höhe von 20 Milliarden Kronen vor, die unter anderem aus den Öllizenzgebühren stammten. Ab 2010 macht sich die Erholung bemerkbar und die Notmaßnahmen werden aufgehoben. Die norwegische Wirtschaft zeigt sich sehr dynamisch und verzeichnet 2013 ein Wachstum von 3 %, das durch die Ölinvestitionen und den privaten Konsum angekurbelt wird. Im Juli 2016 erreicht die Arbeitslosigkeit mit 5 % einen Rekordwert. Das Land wird durch den Rückgang des Ölpreises stark belastet und die Prognosen für das Land sind diesbezüglich wenig optimistisch. Im Jahr 2016 lag die Wachstumsrate des BIP bei 1,1 %.
Norwegen und Coronavirus
Die COVID-19-Pandemie traf die norwegische Wirtschaft Anfang 2020 sehr schnell und die Regierung verhängte sofort eine mehrwöchige Eindämmung. Der Ölpreis brach ein, weil die Energienachfrage aus dem Ausland ausblieb, obwohl dieser Sektor nicht weniger als 17% des BIP, 19% der Investitionen und 52% der Exporte ausmacht. Die Aussichten für Norwegen sind jedoch aus mehreren Gründen gut: Die weltweite Energienachfrage hat sich erholt, die Norweger stützen den Binnenmarkt, konsumieren viel und der Ölfonds hält dem Land den Rücken frei.
Natürliche Ressourcen
Auf der Seite der natürlichen Ressourcen findet man in Norwegen natürlich Erdöl, aber auch Erdgas, Kupfer, Pyrit, Nickel, Eisen, Zink und Blei, und auf der Seite der erneuerbaren Ressourcen: Wasserkraft, Solarenergie, Holz und Windkraft. Erdöl, diese fossile Energie, deren Förderung für die globale Erwärmung verantwortlich ist (siehe IPCC-Bericht vom August 2021), ist die wichtigste natürliche Ressource, die es Norwegen heute paradoxerweise ermöglicht, die Liste der "grünsten" Länder der Welt anzuführen, Königreich der Elektroautos. Die Vorkommen (Öl und Gas) befinden sich hauptsächlich in den Gewässern vor der Küste Nordnorwegens. Auf der Meeresseite exportierte Norwegen im Jahr 2020 trotz des Coronavirus 2,7 Millionen Tonnen Fisch (im Wert von 10,6 Milliarden Euro), womit Fischerei und Aquakultur nach Öl Norwegens zweitwichtigstes Exportgut sind.
Bauern und Fischer
Entlang des Skagerrak im Süden, wo die Küstenebene breiter, die Sommer wärmer und die Böden fruchtbarer sind, findet man eine intensivere Landwirtschaft. Das feuchte Klima, das für reichlich Grasland sorgt, ermöglicht die Viehzucht in pastoraler Form. Früher hatte jedes Dorf seine Almhütten, in die das Vieh im Sommer getrieben wurde. Die große Mehrheit der Bauern tritt Verkaufsgenossenschaften bei, die den Markt regulieren und die Modernisierung der Techniken fördern. Die Milchproduktion, die vom Staat subventioniert wird, ist nach wie vor sehr wichtig. Etwa 2 Millionen Schafe weiden auf den Bergwiesen und im äußersten Norden werden 200.000 Rentiere von den Sami in Halbfreiheit gehalten. Entlang der gesamten Küste betreiben die meisten Bauern neben der Landwirtschaft auch Fischfang, der aufgrund der Seltenheit einiger Fischarten zu einem Zufallsprodukt geworden ist. In den tiefen Gewässern der Fjorde werden Lachse in Wasserfarmen gezüchtet. An der Südküste schließlich wurden die Schiffe für den Walfang in den antarktischen Gewässern ausgerüstet. Dieser Walfang, der lange Zeit ein norwegisches Quasi-Monopol blieb, bekam Konkurrenz von den Sowjets. Nach der Erfindung der Harpunenkanone wurde sie so tödlich, dass mehrere Walarten heute ausgestorben oder vom Aussterben bedroht sind. Zwischen 1987 und 1993 stellten die Norweger den Walfang (mit Ausnahme der Entnahme für wissenschaftliche Zwecke) ein, um den Walen die Möglichkeit zu geben, wieder eine ausgeglichene Reproduktionsrate zu erreichen. Seitdem ist die kommerzielle Jagd auf den Meeressäuger wieder erlaubt und in vielen Restaurants kann man leider wieder Walfleisch essen. Norwegen ist eines der letzten Länder, das diese Praxis trotz des 1986 unterzeichneten internationalen Moratoriums reproduziert.