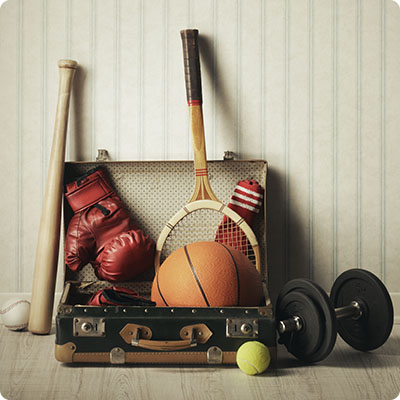Eine typische Alpenfauna
Sowohl in den italienischen Alpen als auch in den Dolomiten leben mehrere emblematische Tierarten. Unter den Säugetieren sind Hasen (Feld- und Alpenhasen), Eichhörnchen, Murmeltiere (die sich stark vermehren) und andere kleine Nagetiere zu erwähnen. Auch der Fuchs (der manchmal sehr vertraut ist) sowie zahlreiche Mustelidae (Hermelin, Wiesel, Marder, Steinmarder und Dachs) sind zu nennen. Auch Huftiere wie Gämse, Wildschwein, Hirsch und Reh werden hier zu sehen sein. Schließlich seien noch die Raubvögel erwähnt, zu denen der Habicht, der Sperber, der Mäusebussard und der Turmfalke gehören, sowie die recht leicht zu sehenden Steinadler. Nachts suchen der Uhu und der Waldkauz die Nacht mit ihrem Gezeter heim.
Der Steinbock, das Symbol der italienischen Alpen
Der Alpensteinbock(Capra ibex) ist ein gedrungenes Tier mit kräftigen Beinen und sehr widerstandsfähigen Hufen. Er ist das Wahrzeichen der alpinen Bergwelt und lässt sich auf den alpinen Wiesen leicht beobachten. Der Steinbock ist eine Ziegenart, die bereits in der Altsteinzeit existierte, wenn man den in den Alpen gefundenen Höhlenmalereien Glauben schenken darf. Ab dem 15. Jahrhundert führte die Entwicklung von Feuerwaffen zu seiner Seltenheit. Er wurde wegen seines Fleisches verzehrt, aber auch in Abkochungen für die traditionelle Medizin verwendet. Jahrhundert fast ausgerottet, als es nur noch einige wenige wilde Herden in Frankreich und Italien gab. Es ist Victor-Emmanuel II. zu verdanken, dass die Art im Aostatal überlebte. Er ließ für seine persönliche Jagd ein königliches Reservat Gran Paradiso einrichten und schützte die Art. Heute ist der Steinbock nicht mehr gefährdet. In Italien soll es etwa 17.000 Tiere geben. Er kommt auch in Österreich, der Schweiz, Deutschland und Slowenien durch Wiederansiedlung der Art vor. Der Steinbock ist ein Felsbewohner und kraxelt über steile Klippen und Felswände. Er ist nicht schwindelfrei! Die Männchen leben in kleinen Trupps, während die Weibchen mit ihren Jungen getrennte Rudel bilden. Die Männchen, die sich durch ihre langen, gebogenen Hörner auszeichnen, sind schon von weitem erkennbar. Im Erwachsenenalter können sie bis zu 1 m lang werden und bis zu 6 kg pro Paar wiegen! Ein dominantes Männchen pro Herde setzt sich in lautstarken, aber wenig gewalttätigen Hornkämpfen durch.
Wölfe hauptsächlich in der Apennin-Region
Wölfe sind für das Gleichgewicht der Biodiversität in den italienischen Alpenbergen von größter Bedeutung und 2017 wurde auf nationaler Ebene ein Plan zur Erhaltung und zum Management von Wölfen gestartet. Der erste Plan dieser Art wurde in den 1970er Jahren ins Leben gerufen, als es im Nationalpark Abruzzen nur noch etwa 100 Wölfe gab. Ein echter Erfolg, denn heute wird ihre Population in Italien auf etwa 2.000 Exemplare geschätzt, was etwa 18% der Wölfe in der Europäischen Union entspricht. Sie werden in zwei Gruppen unterteilt: Apennin in der überwiegenden Mehrheit und Alpin.
Die Population der apenninischen Region lebt im Piemont und in der Lombardei in einem sehr großen Gebiet, etwa 80.000 km2. Die Zahl der Wölfe wird mit der Kelle auf 1800 geschätzt, da sie schwer zu lokalisieren sind. Alpenwölfe leben in kleinen, gebirgigen, grenzüberschreitenden Gebieten mit Frankreich, der Schweiz, Österreich und Slowenien: ca. 12.000 km2. Insgesamt gibt es etwa 200 Exemplare und mehr, die leicht zu beobachten sind. Sie sind in 23 Rudel aufgeteilt, von denen 5 grenzüberschreitend sind.
Ihr Sozialleben ist gemeinschaftlich und familiär. Sie bewegen sich in Rudeln von 2 bis 7 Wölfen über 100 bis 200 km2 Territorium. Obwohl die in den 1970er Jahren geschützte Art zunächst der Canis lupus italicus war , kam es aufgrund ihrer weiten geografischen Wanderungen zu Kreuzungen. Vor einigen Jahren wurde ein Paar, das in der Landschaft um den Gardasee gesichtet wurde, als Romeo und Julia bezeichnet, da das Weibchen aus der Gegend von Verona und das Männchen aus Slowenien stammte.Gesunder Dolomiten-Braunbär
Der Braunbär(Ursus arctos), der in den Bergen vorkommt, wurde ab dem 18. Jahrhundert mit der Zunahme von Schusswaffen immer seltener und verschwand nach den beiden Weltkriegen fast völlig. Im Jahr 1996 gab es nur noch eine winzige Bärenpopulation an der Grenze zu Slowenien. Zu dieser Zeit startete Italien mit Unterstützung der Europäischen Union den Life-Ursus-Plan. Die erste Wiederansiedlung von Bären aus dem benachbarten Slowenien im Brenta-Nationalpark in den Dolomiten, wo er verschwunden war. Ein Paar, dann acht Bären im Jahr 2000. Heute gibt es im Naturpark Adamello Brenta nach den neuesten Schätzungen von 2019 zwischen 82 und 93 Bären, darunter auch Jungbären. In Friaul-Julisch Venetien, in den Grenzgebieten zu Slowenien und Österreich, sind es zwischen 10 und 20 Bären. Eine Population, die in den letzten fünf Jahren um 12% pro Jahr gewachsen ist, was ein Zeichen für die gute Gesundheit der Art ist. Im Jahr 2019 wurde durch eine systematische Überwachung von Schlaffallen die DNA von 66 Bären (ohne Jungbären) beprobt.
Der Braunbär kann bis zu 2 m groß werden und 130 kg bei den stärksten Männchen wiegen. Er kann bis zu 50 km/h schnell laufen, sodass man sich ihm besser nicht nähern sollte, auch wenn der Bär sehr scheu ist und Angst vor der Anwesenheit von Menschen hat - kein Grund, Goldlöckchen zu spielen. Er hat einen sehr starken Geruchssinn, der ihn auf Ihre Anwesenheit aufmerksam macht, lange bevor Sie ihn sehen. Aber keine Sorge, der Braunbär ernährt sich nicht von den zarten Haxen eines Kindes. Wie wir alle wissen, liebt er Honig, seine Lieblingsspeise, und er ernährt sich von Pflanzen, Wurzelsprossen, Insekten, wilden und kultivierten Früchten, Samen und Gemüse. Pro Tag muss er zwischen 12 und 15 kg Nahrung finden, das ist also seine Hauptbeschäftigung. Wie zu erwarten, fällt es diesem außergewöhnlichen Flexitarier, der sehr wenig Fleisch isst, am leichtesten, Obst von Obstplantagen (Äpfel, Birnen, Trauben) und Maisfeldern zu stehlen. Im Herbst hat er nichts anderes im Sinn, als sich für den Winterschlaf vollzustopfen, um Winterspeck anzusetzen. Im späten Frühjahr beginnt die Paarungszeit. Dank seines außergewöhnlichen Spürsinns wird der sehr einsame Braunbär für die Zeit der Fortpflanzung gesellig. Danach geht jeder wieder seiner Wege und das Weibchen kümmert sich allein um ihre Jungen (je nach Wurf 1 bis 3), die zwischen Dezember und Februar geboren werden.
Komplizierte Koexistenz mit großen Raubtieren
Eine junge Wölfin, die gesund war, wurde im April 2021 in der Nähe einer Eisenbahnstrecke tot aufgefunden. Dies ist der erste Fall eines durch einen Unfall gestorbenen Wolfs 2021, während es im letzten Jahr sieben waren: vier Männchen und drei Weibchen, die von Autos gerammt wurden. Diese Unfälle sind symptomatisch für die gute Anpassung der Wölfe in der Region, die sich in dem bewaldeten Berghabitat vermehren und verbreiten. Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, dass jedes Jahr etwa 300 Wölfe sterben, die Hälfte davon durch Wilderei (Schlingen, Fallen, Giftköder und Kugeln).
Was die Debatten über die Wiederansiedlung und Präsenz von Bären betrifft, so sorgen diese, wie in Frankreich, oft für Schlagzeilen. Die Schäden, die durch die Anwesenheit von Bären im Trentino verursacht werden, sind beispielsweise um 30 % gestiegen, werden aber immer noch von einigen wenigen Bären verursacht (laut DNA-Analysen). Insbesondere das Individuum M49, das den Diensten gut bekannt ist, ist sogar in Hütten und Gebäude eingedrungen. Der Störenfried könnte jedoch bald erschossen werden, da eine neue Richtlinie im Februar 2021 die Tötung von Bären und Wölfen vorsieht, die Probleme bei der Koexistenz mit der lokalen Bevölkerung verursachen, was vorher nicht möglich war.
Der Luchs, die mystische Wildkatze der Berge
Diese große Katze mit spitzen Ohren, die von Fotografen im Schnee verewigt wurde, lebt in den Bergen. Aber sie sind sehr selten: Schätzungsweise 40 bis 50 Luchse sollen in den italienischen Alpen leben. Auch er kennt keine Grenzen, und so sind es die diskreten und seltenen Luchse aus Slowenien und Österreich, die gekommen sind, um die italienischen Berggipfel wieder zu besiedeln. Man kann das große Glück haben, einen Luchs zu sehen - oder, was wahrscheinlicher ist, seine Spuren im Schnee - in der Gegend von Belluno und Trient in den Dolomiten, in der Gegend von Tarvisio an der Grenze der friulanischen Dolomiten zu Österreich und Slowenien. Seltener in der Nähe von Lessinia am Ostufer des Gardasees in der Lombardei, aber auch im Aostatal und im Piemont (wahrscheinlich aus der Schweiz kommend).
Eine vielfältige und endemische Flora
In den Talsohlen wachsen verschiedene Laubbäume, wie Esche, Birke, Ahorn und Erle, sowie Buchen und Eiben. In höheren Lagen sind es Nadelbäume, die gedeihen. In den trockensten und sonnigsten Gebieten und vor allem auf besonders flachgründigen und felsigen Böden findet man die Waldkiefer. Die Weißtanne und die Gemeine Fichte dominieren zwischen 1300 und 1800 Metern. Zum oberen Rand des Tannenwaldes hin gibt es einen Übergangsstreifen, in dem Lärche und Zirbelkiefer auftreten, die oberhalb von 2.000 m dominieren. Ab 2.400 m sind die subalpinen Ökosysteme eher Blumenbeete. In den Seen findet man besonders die sehr seltene Wasserpflanze Potamogeton praelongus. Dieser Naturpark spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Erhaltung von Flechten. Es gibt fast 650 Arten, das sind 50 % der Flechten in Trentino-Südtirol, das die flechtenreichste Region Italiens ist.
Zum floristischen Reichtum der Dolomiten gehören endemische Arten wieArenaria huteri, Gentiana froelichi, die prächtige Pianella della Madonna(Cypripedium calceolus) und Daphne blagayana (ein Exemplar von Timeleacea, das in Italien im Gebiet von Raut und Tramontino erst 1989 gefunden wurde). Das Edelweiß(Leontopodium alpinum) ist ein Symbol für das Hochgebirge und wächst in Höhen zwischen 1500 und 3200 m. Es ist eine der am häufigsten vorkommenden Pflanzenarten. Die Pflanze ist in einigen Regionen eher lokal verbreitet und zeichnet sich durch einen leichten Flaum auf der Oberseite der Blätter aus. In der Nähe der großen Seen und der Adria findet man eine prächtige mediterrane Vegetation: Lorbeerbäume, Orchideen und Palmen sowie Bougainvillea und Zypressen. In allen Bergen gibt es saftige Waldbeeren: Heidelbeeren(Vaccinium myrtillus), Walderdbeeren (Fragaria vesca), Himbeeren (Rubusidaeus), Brombeeren(Rubus ulmifolius ) und schwarze Johannisbeeren (Ribes alpinum). Im Unterholz findet man mit etwas Glück die seltene Orchidee Venusschuh, Farne und endemische Pflanzen wie die Dolomiten-Hauswurz(Sempervivum dolomiticum), eine Sukkulente mit fleischigen Blättern. An Bäumen gibt es schöne Kiefern- und Lärchenwälder sowie die Schweizer Schirmkiefer. Auf den Bergwiesen und -weiden blühen Frühlingsanemonen, Soldanella alpina und Krokusse, während im Sommer Lamiaceae und Scrofulariaceae vorherrschen.