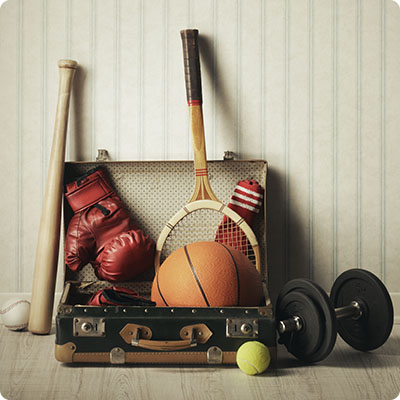Eine überwiegend städtische Bevölkerung
Italien hat 60 360 000 Einwohner (2019) und eine hohe Bevölkerungsdichte von 201 Einw./km². Die bevölkerungsreichsten Regionen sind Latium, Lombardei, Kampanien, Sizilien und Piemont. 70% der italienischen Bevölkerung leben in Städten (75% in Frankreich) und das italienische Städtenetz besteht aus einer großen Anzahl kleinerer Städte. Nur zwei davon haben mehr als eine Million Einwohner: Rom (viertgrößte Stadt Europas, 2,87 Millionen Einwohner) und Mailand (1,37 Millionen), vor Neapel (weniger als 1 Million) und Turin (890.000). Etwa 50 haben mehr als 100.000 Einwohner, 11 davon zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern. Während das Piemont, die Region um Mailand und die Seenregion sehr dicht besiedelt sind, reihen sich in den Dolomiten Dörfer in den Tälern aneinander. Die beiden größten Städte, Bozen und Trient, haben nicht mehr als 250.000 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte ändert sich jedoch mit den Jahreszeiten, wie z. B. in Cortina d'Ampezzo, das in der Nebensaison nur 7 000 Einwohner hat, während in der Ski- und Wandersaison 40 000 Einwohner leben.
Eine alternde indigene Bevölkerung
Die Lebenserwartung liegt bei 80,6 Jahren für Männer und 85,1 Jahren für Frauen und ist damit eine der höchsten in Europa. Die Fertilitätsrate ist mit 1,3 Kindern pro Frau (im Jahr 2019) eine der niedrigsten der Welt und reicht daher nicht aus, um die Generationen zu erneuern. Eine besorgniserregende Demografie für das nach Japan älteste Land der Welt. Diese Zahlen spiegeln ein echtes gesellschaftliches Phänomen wider, einen Mentalitätswandel, der auf die Urbanisierung, den Wohlstand und auch den schwindenden Einfluss der Kirche, insbesondere unter jungen Menschen, zurückzuführen ist. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den Regionen, vor allem zwischen dem "hohen Norden", der ein Geburtendefizit aufweist, und dem Mezzogiorno (Süden), der einen natürlichen Saldoüberschuss aufweist.
Eine historische Süd/Nord-Migration
Während der 1960er Jahre erlebte Italien sein Wirtschaftswunder. Die jährliche Wachstumsrate lag bei 6 % und die Arbeitslosigkeit im Norden war praktisch nicht vorhanden. Im Süden blieb die Lage jedoch ernst und die Kluft zwischen den beiden Teilen des Landes wurde immer größer. Die Bewohner Süditaliens hatten sich bis dahin der Neuen Welt zugewandt: 700.000 New Yorker stammen noch immer von dieser Diaspora ab, und man schätzt, dass heute weltweit 58 Millionen Menschen italienischer Abstammung sind. Doch die florierende Situation im "Industriedreieck" Turin, Genua und Mailand veranlasste viele Kalabresen, Sizilianer und Neapolitaner, sich an Bord des treno del sole zu begeben. Zwischen 1951 und 1961 versuchten schätzungsweise 2 Millionen Süditaliener ihr Glück im Norden, von denen sich fast 600.000 in Mailand niederließen. Die Integration ist natürlich nicht einfach, vor allem wegen einer Art Rassismus. Die verächtlich als terroni (südländische Hinterwäldler) bezeichneten Menschen hatten lange Zeit den Ruf, ignorant, faul und respektlos gegenüber bestimmten hygienischen und vor allem bürgerlichen Normen zu sein. Diese stark betonten Stereotypen verschwanden schließlich in den 1970er Jahren, als sich die Binnenmigration stabilisierte und mit ihr die Integrationsprobleme, sodass heute 50% der Mailänder Bevölkerung südländische Wurzeln hat. Die Zuwanderer aus anderen Ländern haben die Süditaliener ersetzt, aber nur in sehr geringem Maße. Nach der letzten Schätzung aus dem Jahr 2018 leben 5,054 Millionen Einwanderer in Italien, was 8,3 % der Gesamtbevölkerung entspricht.
Eine gemischte italienische Sprache
Die italienische Sprache weist deutliche Spuren der ständigen Vermischung auf, der das Volk jahrhundertelang ausgesetzt war. So sind ragazzo und magazzino (Junge und Lagerhaus) Wörter arabischen Ursprungs (die Araber waren lange Zeit in Sizilien präsent), während albergo, banca, guardia oder sapone
(Hotel, Bank, Wache, Seife) germanischen Ursprungs sind. Karl V. scherzte, dass man mit Gott auf Spanisch, mit den Männern auf Französisch und mit den Frauen... auf Italienisch spricht! Italienisch ist in der Tat eine der melodischsten lateinischen Sprachen. Sie wurde sehr spät gebildet und trat erst im 12. Jahrhundert als literarisches Idiom in Erscheinung, da die Aristokratie und die italienischen Schriftsteller es lange Zeit vorzogen, Latein, Provenzalisch oder Französisch zu sprechen. Diese Entwicklung verlief allmählich, denn Ende des 13. Jahrhunderts schrieb Marco Polo sein sehr berühmtes Il Milione auf Franco-Venezianisch. Nach und nach bildete sich eine Sprache heraus und wurde durch Autoren wie Dante, Boccaccio oder Petrarca formalisiert. Diese verwendeten den toskanischen Dialekt, der den Ursprung des Italienischen, wie wir es heute kennen, darstellt. Ab dem 16. Jahrhundert übte die Renaissance eine Faszination auf Europa aus und es wurden immer mehr Anleihen aus der italienischen Sprache gemacht, insbesondere in den Werken der großen französischen Schriftsteller dieser Zeit.Die regionalen Dialekte des Nordens
Mit der Vereinheitlichung des Bildungswesens, des Fernsehens und des Radios verlieren die Dialekte allmählich an Bedeutung, bleiben aber ein wesentlicher kultureller und historischer Bezugspunkt, um Italien zu verstehen. In der Alpen- und Voralpenregion liegt die Verteilung der Sprachgruppen bei über 60 % Italienischsprachigen und 35 % Deutschsprachigen. Eine kleine Minderheit spricht Französisch und Ladinisch. Weitere Minderheitensprachen sind Okzitanisch (Piemont, Ligurien), Slowenisch (Friaul-Julisch Venetien)... Ebenso wird das Provenzalische von 90.000 Menschen gesprochen, die seit dem 13. und 14. Jahrhundert ansässig sind (Aostatal, nördliches Piemont).
Ladinisch, die Sprache der Dolomiten
Ladinisch ist ein Überbleibsel der romanischen Sprache, die früher in dieser Alpenregion viel häufiger gesprochen wurde. Nur in den abgelegensten und isoliertesten Tälern konnte sich das Ladinische halten. Im Zuge der italienischen Einigung gingen alle Gebiete, in denen ladinische Dialekte gesprochen wurden, nach und nach von der österreichischen unter die italienische Herrschaft über. Die italienische Nationalbewegung betrachtete die ladinischen Dialekte stets als italienische Dialekte, was von denjenigen, die sie sprechen, widerlegt wird. Erst als in Südtirol die Verwaltungsautonomie eingeführt wurde, wurden den Ladinischsprachigen ihre Rechte als kulturelle Minderheit zuerkannt. In den Dolomiten wird noch immer Ladinisch gesprochen: in Cortina d'Ampezzo, im Grödnertal, im Fassatal und rund um Bozen.
Die Dolomiten: dreisprachige Region
Die Autonome Provinz Bozen hat etwa 470.000 Einwohner. Diese verteilen sich auf 116 Gemeinden, von denen die wichtigsten Bozen (Landeshauptstadt), Meran, Brixen, Bruneck, Laives und Vipiteno sind. Südtirol ist, wie das Aostatal, eine offiziell mehrsprachige Region. Tatsächlich sind zwei Drittel (70 %) seiner Einwohner deutsche Muttersprachler und weniger als 5 % ladinische Muttersprachler aus den Dolomiten. Die Italienischsprachigen (25 %) leben vor allem in der Landeshauptstadt Bozen (Bolzen) und in den Orten Meran (Meran), Brixen (Brixen), Laives (Leifers) und Bronzolo (Branzoll). Die Ladinischsprachigen (5 %) leben vor allem im Grödnertal (Gherdëina) und im Gadertal. In der Autonomen Provinz Bozen ist die Beschilderung vollständig zweisprachig, sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch. Sie werden dort eher Grüssgot (Guten Tag auf Bayerisch) als Bongiuourno hören. In den ladinischsprachigen Gemeinden der Provinz ist die Beschilderung überwiegend dreisprachig (ladinisch, deutsch und italienisch).
Französisch im Aostatal
Als historisch französisch-provenzalische Region innerhalb der Staaten von Savoyen und später des Königreichs Piemont-Sardinien folgte das Aostatal nicht dem Schicksal von Savoyen und Nizza, die 1860 durch ein Plebiszit an Frankreich angeschlossen wurden, sondern blieb Teil des neuen italienischen Einheitsstaats. Von da an kämpfte die Region immer wieder gegen die Angriffe auf ihre Kultur. Besonders gewalttätig war die Zeit des Faschismus, in der eine systematische Italianisierungspolitik betrieben wurde. Das Verbot der französischen Sprache trug dazu bei, die isolierte Berggesellschaft nachhaltig zu erschüttern. Alle Ortsnamen wurden italianisiert (Aosta in Aosta, Saint-Pierre in San Pietro, Morgex in Valdigna d'Aosta, Chamois in Camosio, Champorcher in Campo Laris usw.). Da das Französische verbannt wurde, beschränkte sich die Bevölkerung auf die mündliche Ausübung des Frankoprovenzalischen, das von den Behörden geduldet wurde. Als Reaktion auf diese autoritären Maßnahmen bildete sich eine kulturelle Widerstandsströmung, die von einem jungen Juristen, Emile Chanoux, angeführt wurde. Dieser führte die "Ligue valdôtaine pour la protection de la langue française dans la vallée d'Aoste" an und setzte sich systematisch für die Verteidigung des Französischen ein. Seine sprachlichen Forderungen werden bald mit föderalistischen Forderungen einhergehen. Als Flüchtling in Frankreich kehrte Chanoux 1943 in das Aostatal zurück. Dort wurde er am 18. Mai 1944 von den faschistischen Behörden verhaftet und starb noch in der Nacht. Charles de Gaulle, der für die Sprachenfrage empfänglich war, hatte einen Moment lang die Annexion des Aostatals an Frankreich in Erwägung gezogen und wurde dabei von einer starken rattachistischen Strömung unter den Valdostanern ermutigt. Der erbitterte Widerstand der Amerikaner und die jahreszeitlich bedingten Schwierigkeiten bei der Durchreise zwischen Frankreich und dem Tal (es gab keine Tunnel) führten jedoch dazu, dass dieses Projekt aufgegeben wurde. De Gaulle wird jedoch die Zusicherung einer Autonomieregelung für das Tal erreichen. Die Nachkriegszeit brachte mit dem Autonomiestatut eine offizielle Rückkehr der französischen Sprache. Die 1960er und 1970er Jahre beschleunigten mit der industriellen und touristischen Entwicklung die Modernisierung der Region. Heute ist es nicht ungewöhnlich, im Tal Französisch zu hören, das auch in den Hochtälern des Piemonts gesprochen wird.
Der Mailänder Dialekt: ein uraltes Erbe
600 v. Chr. ließen sich die Gallier in der Gegend um Mailand nieder, und ihre Kultur beeinflusste das Leben und die Sitten der bereits existierenden Bevölkerung. Der Name Mailand selbst soll vom keltischen Wort Mediolanum abgeleitet sein. Auch der Name Brianza (das geografische Gebiet nordöstlich von Mailand) leitet sich vom keltischen Wort brig, "höher gelegener Ort", ab, und Lecco vom Wort leukos
, "Wald". Ab 222 v. Chr. wurde Mailand von den Römern besetzt. Das klassische Latein, das nur von den Eliten gesprochen wird, wird vom Volk popularisiert und zum offiziellen Idiom. Die Vermischung der "barbarischen" mit den romanisierten Völkern beschleunigt die Popularisierung des Lateins und bringt den Mailänder Dialekt hervor, der auch Meneghino genannt wird, d. h. die Sprache, die von den Dienern, dem kleinen Volk, gesprochen wird. Der Mailänder Dialekt ist dem Französischen also sehr ähnlich, da er zu 70 % aus Wörtern lateinischen Ursprungs besteht. Wie bei den meisten italienischen Dialekten hat der Einfluss der Fremdherrschaft jedoch sehr starke Spuren hinterlassen. So finden wir im Mailänder Dialekt Wörter spanischen, österreichischen und französischen Ursprungs: Artischocke wird auf Mailändisch zu articiock und Schinken zu giabun.