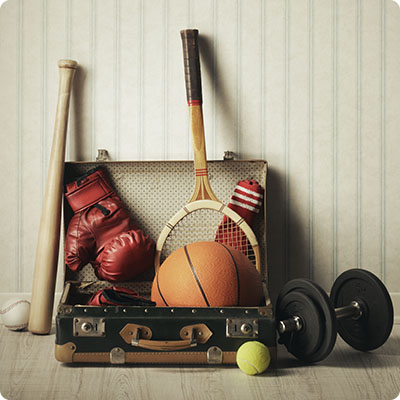3350 av. J.-C
Der Mann aus dem Eis Ötzi
Die frühe Anwesenheit von Menschen in Italien wird durch archäologische Funde belegt, vor allem in den italienischen Alpen, die uns hier interessieren. Besonders zu erwähnen ist der Fund von Ötzi in Südtirol aus dem 4. Jahrtausend v. Chr.: Ein 1991 in den Dolomiten nahe der österreichischen Grenze entdeckter Mann aus dem Eis, aus der Chalkolithikum. Natürlich mumifiziert (gefroren und dehydriert), in 3210 m Höhe, wurde seine Existenz durch das starke Abschmelzen des Gletschers im Sommer enthüllt. Derzeit ist er im Archäologischen Museum in Bozen ausgestellt.
800 av. J.-C
Die Etrusker
Der Ernst des Lebens beginnt, wenn Horden von Invasoren die Alpenpässe überqueren. In der Eisenzeit sind die italienischen Völker die Ligurer, Rheten, Veneter und Etrusker. Die markanteste Invasion war die der Etrusker um 800 v. Chr.. Sie absorbierten die einheimischen Bräuche und ließen eine eigenständige Kultur entstehen, die sich von Latium bis nach Umbrien und Venedig erstreckte. Im 7. Jahrhundert v. Chr. erlebten sie einen großen wirtschaftlichen Aufschwung und exportierten Bronzegegenstände und Keramiken in den Mittelmeerraum. Dabei gerieten sie jedoch häufig mit den Griechen und Karthagern aneinander. Sie beeinflussten die Römer in den Künsten und in der Wahrsagerei. Das Archäologische Museum in Turin zeigt etruskische Überreste aus der Region.
200 av. J.-C
Die Annexion durch das Römische Reich
Während im Süden die etruskischen Städte ihre Unabhängigkeit von Rom verlieren, zerstören im Norden die Einfälle der Kelten die Städte der Poebene. Die römische Eroberung der Region dauert ein Jahrhundert. Es sind vor allem die Karthager, die ihnen das Leben schwer machen. Im Zweiten Punischen Krieg überquert Hannibal die Alpen auf dem Rücken eines Elefanten. Es gelingt ihm jedoch nicht, Rom einzunehmen, und er zieht sich zurück. Dies ist der Beginn der römischen Hegemonie. Das Archäologische Museum in Pordenone stellt Überreste der Romanisierung in den friaulischen Dolomiten aus.
568
Langobardeninvasion durch König Alboïn
Die Päpste, die nacheinander an der Spitze des Heiligen Stuhls standen, erschienen als die einzigen Interessenvertreter der Italiener, die vom byzantinischen Kaiser ihrem Schicksal überlassen worden waren. Ende des 6. Jahrhunderts fielen die Langobarden in Norditalien ein und besetzten bald auch die Poebene. Sie gründeten in der Region Herzogtümer, darunter Friaul, Ceneda, Treviso, Trient, Mailand, Bergamo, San Giulio und Turin. Langobardische Keramiken sind im Archäologischen Museum in Mailand ausgestellt. Angesichts der Bedrohung durch die Langobarden bat Rom die Franken um Hilfe, als diese in Europa einfielen.
774
Karl der Große, König der Franken und Langobarden
Zu dieser Zeit wurde Karl der Große, der König der Franken, zum eigentlichen Herrscher der Halbinsel und gliederte Norditalien mit Ausnahme von Venedig seinem Reich an. Das lombardische Herzogtum Benevento blieb unabhängig und das Byzantinische Reich herrschte weiterhin über Süditalien, Kalabrien und Sizilien. Die Nord-Süd-Teilung Italiens geht auf diese Zeit zurück. Mit dem Niedergang des Karolingerreichs begann für Italien eine lange Zeit der Unruhen, die von den Kämpfen der Potentaten um den Titel des Königs von Italien und den Verwüstungen durch die Sarazeneneinfälle geprägt war. Selbst das Papsttum blieb nicht verschont und fiel in die Hände aristokratischer Familien.
951
Invasion von König Otto I
Der König von Germanien dringt in den Norden der Halbinsel ein, eignet sich Italien an und lässt sich zum Kaiser krönen (962). Dies ist eine Zeit relativer Stabilität in Italien. Die Herrschaft der deutschen Kaiser etablierte sich für drei Jahrhunderte, wobei sie immer wieder mit den Unabhängigkeitsbestrebungen der adligen römischen Familien und großen Feudalherren wie dem langobardischen Herzog Pandolf Eisenhaupt zusammenstießen. Um deren Emanzipationsbestrebungen entgegenzuwirken, mussten die Kaiser den Aufschwung der Städte unterstützen, die im Laufe des 11. Jahrhunderts durch den Handel aufblühten und sich gerade von den Feudalherren, denen sie gehörten (Bischöfe, Erzbischöfe, Capitani usw.), emanzipierten. Dies gilt für Venedig, das von jeglicher Vasallität befreit ist und weiterhin mit dem byzantinischen Osten Handel treibt, sowie für Genua und Pavia.
XIIe siècle
Die Dynastie der Hohenstaufen
Der Kampf zwischen den deutschen Kaisern und dem Papsttum erreicht mit der Dynastie der Hohenstaufen eine neue Phase. Der erste, Friedrich I. Barbarossa, bemühte sich um die Wiederherstellung der kaiserlichen Autorität. Er stellte sich gegen die Kirche und die nunmehr entmachteten lombardischen Städte, die dem Kaiser 1176 in der Schlacht von Legnano eine vernichtende Niederlage zufügten. Trotzdem mussten sich die lombardischen Städte erneut damit abfinden, unter dem kaiserlichen Joch zu leiden. Der letzte Staufer, Konradin, wurde 1268 besiegt, was das Ende der deutschen Herrschaft über Italien bedeutete.
XIIIe siècle
Die großen Städte
Da die Germanen weg sind, gehen die internen Kämpfe in der Lombardei weiter, die für die alten Handelsfamilien an der Macht äußerst ruinös sind. Mailand fiel in die Hände der Visconti, Verona in die der Scaligeri... Sie errichteten tyrannische Regime und stellten so Ordnung und Wohlstand wieder her. Die meisten von ihnen sind auch große Mäzene. In Norditalien dominieren drei große Städte die politische und wirtschaftliche Landschaft: Mailand (aber 1450 werden die Visconti von den Sforza vertrieben), Venedig, eine oligarchische Republik und Seemacht (die ihre Hegemonie 1453 durch die Eroberung Konstantinopels durch die Türken in Frage gestellt sieht) und Florenz, das in Bezug auf Literatur und Kunst ein kultureller und geistiger Brennpunkt Europas ist.
1494
Lombardei zwischen Frankreich und Heiligem Stuhl hin- und hergeworfen
Karl VIII. wurde in Mailand, wo er beim Sturz der Sforza half, und in Florenz, wo die Medici das gleiche Schicksal ereilte, freundlich aufgenommen und eroberte 1495 Neapel. Angesichts der Bedrohung durch die italienischen Koalitionstruppen von Papst Alexander VI. von Venedig und Ludovico Sforza, der erneut Herzog von Mailand wurde, musste er jedoch darauf verzichten, Neapel dauerhaft zu besetzen. Während der Rückeroberung der Macht durch den Heiligen Stuhl wird die Lombardei zu Beginn des 16. Jahrhunderts zum Schauplatz blutiger Schlachten.
1529
Franz I. überträgt Italien an die Habsburger
Auf einen Valois folgte mit Franz I. ein anderer Valois, der die italienischen Kriege unmittelbar nach seinem Amtsantritt wieder aufnahm. Der berühmten Schlacht von Marignano (1515), in der die Franzosen gemeinsam mit den Venezianern gegen die Mailänder und Schweizer siegten, stand die Katastrophe von Pavia (1525) gegenüber, eine Schlacht gegen die Aragonier und die kaiserlichen Truppen Karls V., in der Franz I. gefangen genommen wurde. Der französische König, der ein Jahr später gegen Lösegeld freigelassen wurde, nahm die Waffen wieder auf und erklärte sich 1529 im Vertrag von Cambrai bereit, mit Karl V. zu verhandeln und Italien an das Habsburgerreich abzutreten.
1559
Die Herrschaft der spanischen Habsburger
Von diesem Zeitpunkt an war sie im Norden der Halbinsel vollständig, zerschlug die letzten oppositionellen Bestrebungen der lombardischen und toskanischen Städte und setzte die Medici wieder an die Spitze von Florenz. Im Vertrag von Cateau-Cambrésis im Jahr 1559 überließ das Königreich Frankreich die italienische Halbinsel endgültig der Herrschaft der Habsburger, die bis 1792 andauerte. Zwei politischen und wirtschaftlichen Einheiten gelang es dennoch, eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren: Savoyen, das ab 1562 seine Hauptstadt in Turin errichtete, und Venedig, dessen Besitzungen und dessen Wirtschafts- und Handelsmacht trotz des Sieges von Lepanto (1571) durch den unaufhaltsamen Vormarsch der Türken geschwächt wurden.
XVIIe et XVIIIe siècles
Der Nachfolgekrieg
Diese Jahrhunderte bringen Italien weitere Zerstörungen während der großen europäischen Kriege zwischen dem Frankreich der Bourbonen und dem Spanien der Habsburger. Nach dem Tod von Karl II. von Spanien, dem letzten Vertreter der spanischen Dynastie, litt der Norden der Halbinsel unter den Habsburger Erbfolgekriegen. Der 1713 im Vertrag von Utrecht geschlossene Frieden übertrug Philipp V., dem Enkel Ludwigs XIV., den spanischen Thron und ersetzte die spanische durch die österreichische Hegemonie. Vor allem aber stärkte er die Macht des unabhängigen Savoyens, das 1720 Sardinien erhielt. Zwischen 1734 und 1738 sowie zwischen 1741 und 1748 entflammten zwei Erbfolgekriege erneut den Norden des Landes.
1748
Der Vertrag von Aachen
Dieser Vertrag beendete die Feindseligkeiten und legte die politische Teilung Italiens fest: Der Kirchenstaat teilte die Halbinsel immer noch in zwei Hälften, während Savoyen seine Positionen im Piemont und auf Sardinien ausbaute. Dasselbe Savoyen, das im Laufe des 18. Jahrhunderts den aufgeklärten Despotismus seiner Prinzen (Viktor Amadeus II., gefolgt von Karl Emanuel III.) erlebte, der von den anderen Regenten der italienischen Fürstentümer nachgeahmt wurde. Trotz dieser Reformen wuchs jedoch die Kluft zwischen dem Norden, der für die philosophischen Ideen Europas empfänglich war, und dem Süden, der von Großgrundbesitzern beherrscht wurde, die den Stillstand befürworteten.
1805
Bonaparte vereint das Königreich Italien
Napoleons französische Revolutionstruppen eroberten zunächst Savoyen und drangen erst im Frühjahr 1796 in Norditalien ein. Ein Jahr später wurde in Campo Formio Frieden geschlossen (was das Ende Venedigs als Staat bedeutete): Norditalien wurde in freie Republiken gegliedert, denen sich nach ihrer Eroberung die Republiken des ehemaligen Kirchenstaates und des ehemaligen Königreichs Neapel anschlossen. Trotz der kriegerischen Ausschreitungen entdecken die Italiener die Freiheit. Eine "italienische Seele" scheint geboren zu sein. Nach der Ausrufung des französischen Kaiserreichs im Jahr 1804 werden die italienischen Republiken 1805 von Napoleon zum "Königreich Italien" zusammengeschlossen. Zwischen 1805 und 1809 kamen Venetien und das Trentino hinzu. Auch wenn der Kaiser nie den Willen hatte, Italien zu vereinen, wurde dies de facto verwirklicht: Der Gesetzeskodex Napoleons regelte das Bürgerleben, das den Ursprung des späteren Risorgimento von Garibaldi, dem "Vater der Nation", darstellte. Doch das "einheitliche" Experiment endete mit dem Erwachen der europäischen Feinde des Kaisers.
1813
Die österreichische Invasion
Im Oktober 1815 wird die gesamte Halbinsel von den Truppen des Kaisertums Österreich (Erbe der Habsburger-Dynastie) erobert. Dies bedeutet eine Rückkehr zu despotischen Regimen. Die italienischen Prinzen erhielten ihre Herzogtümer zurück, Österreich erhielt die Lombardei zurück, der Kirchenstaat und Piemont wurden wiederhergestellt. Das Volk wird mit Repressionen überzogen. Es entwickelt sich ein Nationalbewusstsein, das von den Geheimgesellschaften, den berühmten Carbonari, die sich aus Intellektuellen, Offizieren und Richtern zusammensetzen, weitergetragen wird. Diese Aktionen werden niedergeschlagen, wie die Aufstände von 1820 im Piemont. Die Idee einer nationalen Einheit machte ihren Weg, aber drei Strömungen standen sich gegenüber. Die erste befürwortete eine Konföderation der italienischen Fürstentümer unter der Führung des Papstes, die zweite setzte sich für eine einheitliche Republik ein, und die dritte träumte ebenfalls von einer Föderation, die jedoch unter der Schirmherrschaft des Königreichs Piemont stehen sollte. Die letztgenannte Strömung gewann 1860 die Oberhand.
1848
Ein neuer italienischer Staat
Nach Volksaufständen muss der piemontesische König Karl Albert unter Druck eine konstitutionelle Ordnung in seinem Königreich einführen. Gleichzeitig erhob sich die Lombardei gegen die österreichischen Besatzer, dem sich der König von Piemont anschloss, der erklärte, "l'Italia farà da se" ("Italien wird sich selbst machen"). Hinzu kamen Verstärkungen, die von anderen italienischen Fürsten und sogar vom Papsttum geschickt wurden. Aufgrund der Uneinigkeit und des Übertritts des Papstes war Karl Albert von Savoyen jedoch bald allein mit den Österreichern konfrontiert und musste im August 1848 einen Waffenstillstand unterzeichnen. Nachdem er das Wichtigste gerettet hatte, nahm Karl Albert 1849 den Kampf wieder auf, wurde aber erneut geschlagen und dankte zugunsten seines Sohnes Viktor Emanuel II. ab.
1820 – 1878
Victor-Emmanuel II
Nachdem das Königreich Piemont mit den von Österreich unterstützten absolutistischen Regimen in Italien allein gelassen wurde, kam 1852 ein Mann namens Cavour an die Spitze seiner Angelegenheiten, dessen diplomatisches Geschick zur Einheit Italiens unter der Ägide von Viktor Emanuel II. führen sollte. Durch den Vertrag von Turin 1860 fielen Savoyen und Nizza an Frankreich unter Napoleon III. zurück, der im Gegenzug Piemont militärische Hilfe gegen Österreich gewährte. Der Krieg, der durch die Schlachten von Magenta (4. Juni 1859) und Solferino (24. Juni) gekennzeichnet ist, verläuft siegreich. Piemont erhielt die Lombardei zurück, nicht aber Venetien, das in österreichischer Hand blieb. Piemontesische Truppen marschieren in den Kirchenstaat ein und setzen dann die Autorität des Königs in Neapel durch. Viktor Emanuel II. wurde 1861 zum König von Piemont ausgerufen, und zwar durch - was neu war - "den Willen der Nation", d. h. des gesamten italienischen Volkes. Florenz wurde zur Hauptstadt des jungen italienischen Staates, während Rom weiterhin vom Papst und den französischen Streitkräften, die ihn beschützen sollten, besetzt war.
1870
Rom endlich Hauptstadt
Erst 1870, nach dem Abzug der Truppen von Napoleon III - der französisch-preußische Krieg zwang ihn dazu -, wurde Rom schließlich mit der Nation vereint und zur Hauptstadt ernannt. Das Museo del Risorgimento in Mailand fasst die italienische Einigung von Napoleons Italienfeldzug bis zur italienischen Nation zusammen, dank der gemeinsamen Aktionen von Garibaldi, Viktor Emanuel II, Cavour und Mazzini, die als "Väter des Vaterlandes" gelten. Als die Einheit des Landes endlich erreicht war, wurde sich Italien seiner wirtschaftlichen Rückständigkeit im europäischen Maßstab bewusst, seiner Entwicklungsunterschiede zwischen dem industriellen Norden des Mezzogiorno und dem fast ausschließlich ländlichen Süden. Die arme Bevölkerung des Südens wird zur Auswanderung gedrängt, hauptsächlich in die Neue Welt. Es ist auch die Zeit der Expansion des italienischen Kolonialismus. Politisch gesehen war die parlamentarische Monarchie aufgrund des geltenden Zensussystems fragil. Erst 1912 setzte sich schließlich das allgemeine Wahlrecht durch.
1914 - 1918
Der Erste Weltkrieg
Die italienischen Dolomiten, die zu Beginn des Krieges zu Österreich-Ungarn gehörten, wurden vom Ersten Weltkrieg schmerzlich gezeichnet, da ihre Kämme die Frontlinie bildeten. Italien erklärte Österreich-Ungarn (Mai 1915) und anschließend Deutschland (August 1916) den Krieg. Zwischen 1915 und 1918 standen sich Italiener und Österreicher in unglaublich barbarischen Kämpfen gegenüber. Die Soldaten beider Seiten hoben Schützengräben aus, rüsteten die steilen Wände aus, um sich darin bewegen zu können, und legten Berge und Gletscher frei, um Stollen, Schlafräume, Waffen- und Munitionslager sowie Krankenhäuser zu schaffen... Auf der Skitour First World War Tour können Sie die Überreste der Schlacht in den Dolomiten bewundern. Im Vertrag von Saint-Germain, der den Frieden zwischen den Alliierten und Österreich herstellt, erwirbt Italien das Trentino und Triest.
1922
Mussolinis Marsch der Braunhemden
1919 gründete Mussolini in Mailand die Italienischen Kampfbündnisse. Soziale Unruhen, Gewalt, die offensichtlichen Mängel des parlamentarischen Systems und die Instabilität der Regierung kommen dem Faschismus und Mussolini zugute, der am 28. Oktober 1922 mit seinen Schwarzhemden den berühmten Marsch auf Rom organisiert. Am 30. Oktober rief König Viktor Emanuel III. den Duce an die Macht. Zunächst respektiert Mussolini das parlamentarische System, organisiert aber 1924 Wahlen, die seine Vormachtstellung weiter festigen. Die faschistische Diktatur begann, und seine Außenpolitik wurde nach der Eroberung Äthiopiens Ende 1935 brutal radikalisiert.
1939-1945
Der Zweite Weltkrieg
Als Hitler 1939 gegen England und Frankreich isoliert war, folgte Mussolini ihm nicht. Doch als die Alliierten im Juni 1940 von den Deutschen besiegt werden, tritt Italien in den Krieg ein und marschiert in Frankreich ein. Die schlecht vorbereitete Armee stolpert jedoch von einer Niederlage in die nächste und der Protest des Volkes wächst in den Reihen der faschistischen Partei, dem Großen Rat. Im Juli 1943 setzt dieser Mussolini ab und verhaftet ihn. Eine neue Regierung verhandelt mit den Alliierten über einen Waffenstillstand. Deutschland wird gewarnt und schickt seine Truppen, um Rom und Norditalien zu besetzen. Nach seiner Befreiung baut Mussolini mit Hilfe der Nazis einen faschistischen Staat im Norden wieder auf: die Republik von Salo. 1945, als die Alliierten auf dem Vormarsch waren und Hitler auf sich allein gestellt war, wurde Mussolini erneut verhaftet und zusammen mit seiner Geliebten summarisch hingerichtet, wobei ihre Überreste an den Füßen aufgehängt und auf einem Platz in Mailand dem Zorn des Volkes zum Fraß vorgeworfen wurden. Das besiegte Italien verlor seine kolonialen Besitzungen sowie die Besitzungen aus dem Ersten Weltkrieg, d. h. Fiume, Istrien, die Stadt Zara und einen Teil von Julisch Venetien, die an die Jugoslawen fielen.
1948
Die christdemokratische Nachkriegszeit
Als der Frieden zurückkehrte, organisierte das Komitee für die nationale Befreiung Wahlen und ein Referendum, das die Monarchie verurteilen sollte. Humbert II., der seit der Abdankung seines Vaters Viktor Emanuel III. auf dem Thron saß, entschied sich für das Exil. Die neue Verfassung, die 1948 verabschiedet wurde, räumte dem Ratspräsidenten, dem Regierungschef und eigentlichen Inhaber der Exekutivgewalt, großen Einfluss ein. Das politische Leben ist geprägt vom Machtkampf zwischen einigen großen Parteien, die aus dem Widerstand hervorgegangen waren, wie der Kommunistischen Partei (PCI), der Sozialistischen Partei (PSI), der Republikanischen Partei (PRI), den Sozialdemokraten und schließlich der Christdemokratie (DC). Letztere genießt bei den Italienern ein großes Ansehen und wird in allen 32 Regierungen vertreten sein, die zwischen 1946 und 1974 an der Spitze Italiens stehen. Das politische Leben ist jedoch von ständigen Krisen geprägt.
1970
Die bleiernen Jahre
Im Autunno Caldo ("heißer Herbst") 1969 sah sich Italien mit Streiks, Demonstrationen, Unruhen und unkontrollierbarem gewalttätigem Aktivismus konfrontiert, insbesondere von den Roten Brigaden und rechten Gruppierungen. Ministerpräsident Aldo Moro wurde 1978 von den Roten Brigaden entführt und später getötet, nachdem die Regierung sich geweigert hatte, zu verhandeln. Nach zahlreichen Bemühungen wurde der Terrorismus um 1985 mithilfe der Vitalität der italienischen Wirtschaft nahezu ausgerottet. Doch Italien sah sich mit einer Reihe von Skandalen konfrontiert, die das Ausmaß der Korruption im Land und die Macht der Mafia über das wirtschaftliche und politische Leben offenbarten. Die Operation Mani Pulite ("saubere Hände") im Jahr 1992 zielte darauf ab, das politische und öffentliche Leben zu sanieren.
1992
Die Berlusconi-Ära
Der milliardenschwere Medienmogul Silvio Berlusconi, der 1996 und 2001 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, sieht sich einer wachsenden Feindseligkeit gegenüber, die 2005 ihren Höhepunkt erreicht, als 12 von 16 Regionen von der Mitte-Links-Partei der Demokraten gewonnen werden. Im Jahr 2006 wurde der Vorsitzende dieser Partei, Romano Prodi, zum italienischen Ministerpräsidenten gewählt. Der Cavaliere , der auf der rechten Seite in Schwierigkeiten geriet, gründete die Partei Volk der Freiheit (PDL), kehrte zu alter Stärke zurück und gewann die Parlamentswahlen 2008 mit großem Vorsprung. Die internationale Krise, Skandale um Korruption, Veruntreuung und Prostitution von Minderjährigen (Rubygate) schwächen ihn jedoch. Die Kommunalwahlen 2011, bei denen Neapel und vor allem Mailand, die historische Hochburg des Cavaliere, verloren gingen, veranlassten ihn im November zum Rücktritt.
2011
Die Rückkehr der Demokraten
Eine neue Regierung von Technokraten unter der Leitung des ehemaligen EU-Kommissars Mario Monti wird vom Parlament eingesetzt, mit dem Ziel, die Wirtschaft durch Haushaltsbeschränkungen zu retten. Die Parlamentswahlen 2013 bestätigen jedoch den Sieg der Mitte-Links-Koalition der Demokratischen Partei (29,5 %), dicht gefolgt von Mitte-Rechts (29,1 %) und weit vor Mario Monti (10,5 %). Es scheint schwierig zu sein, eine Regierungsmehrheit zu erreichen. Bis zum Eintritt von Matteo Renzi, dem ersten Sekretär der P.D., in die Politik begann eine politische Krise. 2016 lehnten die Italiener in einem Referendum mit 60 % die von Renzi durchgeführte Verfassungsreform ab, woraufhin er sein Amt niederlegte. Der Regierungschef hieß damals Paolo Gentiloni, doch bei den Wahlen 2018 wurden die Karten neu gemischt.
2018
Die euroskeptische und populistische Versuchung
Bei den Parlaments- und Parlamentswahlen 2018 kam eine Koalition an die Macht, die von Matteo Salvini (37 % der Stimmen) von der rechtsextremen Lega Nord angeführt wurde und mit Forza Italia, der ehemaligen Partei Berlusconis, zusammenarbeitete. Ihre Ideen: Nationalismus, Konservatismus, Rassismus, Euroskeptizismus. Der zweite ist die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), angeführt von Luigi di Maio, eine populistische "Anti-System"-Partei, die ebenfalls euroskeptisch ist. Der große Verlierer ist die von Renzi geführte Mitte-Rechts-Koalition (22,9 % der Stimmen). Die Italiener machten sich vor allem Sorgen über die Migrations- und Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit und die Ablehnung der EU-Politik.
Septembre 2019
Das Bündnis 5 Sterne - Demokraten
Guiseppe Contes Koalitionsregierung aus Lega Nord und M5S zerbricht, als der rechtsextreme Führer Matteo Salvini die Tür zuschlägt, um vorgezogene Wahlen zu provozieren. Die M5S bildete jedoch wider Erwarten eine Koalition mit der Mitte-Links-Partei PD, um eine neue Regierung zu bilden, wodurch die Lega Nord de facto in die Opposition gedrängt wurde.
Février 2020
Absatz ohne Titel
Die Covid-19-Epidemie brach in Norditalien aus, hauptsächlich in der Lombardei und in Venetien, den beiden größten Clustern in Europa, bevor sie sich auf das ganze Land und den Rest Europas ausbreitete und das Land in eine lange Isolation stürzte.