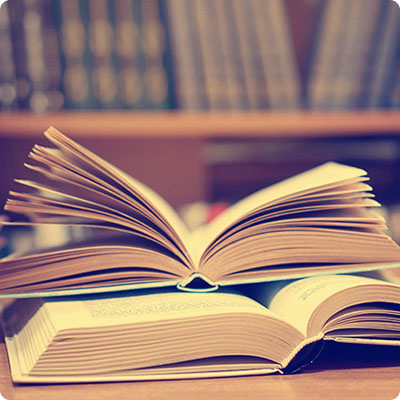Ursprünge und Traditionen
Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Republik Kongo von großen Königreichen geprägt, die sowohl politische als auch spirituelle Macht ausübten, und die Architektur war ein Mittel, um diese Macht vor aller Augen zu verdeutlichen. Zu den Zeugen dieser Königreiche gehört die Domaine Royal de Mbé, die das zentrale Glied des Königreichs der Teké bildete. In der Tradition der Teké wurde eine Hauptstadt jedes Mal verlassen, wenn ein Herrscher starb. Sobald die Hauptstadt verlassen war, wurde sie wieder in die Natur zurückversetzt und zu einem heiligen Wald. Die Überreste der königlichen Domäne umfassen die ehemalige Hauptstadt Mbé und die Residenz der Königin sowie magisch-religiöse Elemente wie heilige Quellen und Wasserfälle, die das Wasser für die königlichen Rituale liefern, und einen heiligen Bereich, in dem Initiationsriten durchgeführt wurden.
Eine weitere historische Sehenswürdigkeit ist der Ancien Port d'Embarquement des Esclaves de Loango. Hier werden sowohl die Geschichte des Königreichs Loango, dessen wichtigstes Zeugnis der Königspalast mit seinen riesigen Räumen ist, der heute als Museum dient, als auch die Geschichte des Sklavenhandels erzählt. Die Stele, die den Start der Karawanen markiert, der Handelsmarkt und die Anlegestelle stehen für eine der größten transozeanischen Deportationsoperationen. Die heiligen Bäume zeigen, dass die Bevölkerung des Landes trotz allem ihre Identität und ihre Traditionen nie aufgab und vor der Abreise Rituale zum Schutz der Seelen durchführte. Eine äußerst bewegende Stätte, um nie zu vergessen.
Diese Beziehung zur Natur ist auch in der volkstümlichen Architektur sehr präsent. Ursprünglich wurden die Dörfer vor allem hoch oben auf den Hügeln gebaut, damit die Bewohner sich vor Angriffen und Überschwemmungen schützen konnten. Heute siedeln sich jedoch viele in der Nähe von Verkehrswegen an, sei es auf Flüssen, Straßen oder Schienen. Die Grundeinheit des Dorfes ist der Clan, der ein Viertel bewohnt, das oft durch Pflanzenhecken von den anderen Vierteln getrennt ist. Auch innerhalb der Dörfer ist die Vegetation präsent, wobei den Obstbäumen eine besondere Bedeutung zukommt. Zu den Vorzeigebauten des Dorfes gehören : das Männerhaus mit Wänden aus gebrannten oder ungebrannten Ziegeln oder aus Poto-poto, die oft weiß getüncht und mit Mustern verziert sind; die Kochnische, die den Frauen vorbehalten ist; die Palaverhütte, in der sich die Gemeinschaft versammelt und die von einer einfachen Form (Pfosten, die ein Dach aus Stroh oder Ziegeln der Raphiapalme tragen) bis zu einer aufwändigeren Form (Lehmbau) reichen kann ; backöfen (für Brot und Ziegel); Ställe; Speicher und Hühnerställe; und Kakaobohnen-Trockner, kleine feste Hütten mit Matten- oder Blechdächern, die Schienen haben, auf denen die Trockengestelle gleiten.. diese Struktur brachte ihnen den Spitznamen "Bustrockner" ein! Bei den individuellen Behausungen haben die Hütten meist einen rechteckigen Grundriss mit konischen, zwei- oder vierseitigen Dächern. In den Savannengebieten sind die bevorzugten Materialien Stroh oder Pflanzenziegel für das Dach und Lehm (eine Mischung aus Schlamm und Stroh oder Palmblättern) für die Wände. In den Waldgebieten werden die Dächer meist aus Bambusziegeln oder geflochtenen Palmblättern hergestellt. Die Wände hingegen werden meist aus Schlamm gebaut, der auf Holz- oder Bastlatten aufgetragen wird, die ein Leistensystem bilden. Im Süden kann man auch Häuser aus zersplitterten Brettern sehen. Heutzutage werden diese natürlichen Materialien eher von moderneren Materialien wie Beton und Blech verdrängt. Trotz allem bestehen einige faszinierende traditionelle Lebensräume fort. Dies ist der Fall bei den Pygmäenhütten, die vollständig aus pflanzlichen Materialien gebaut sind. Diese Hütten bestehen aus einem weichen Holzrahmen, der zu einer Kuppel gebogen ist, auf den dünne Äste und dann große Blätter gelegt werden, und der mit verschiedenen Pflanzenfasern versehen wird, um das Ganze stabiler und wasserdicht zu machen. Die Bangangulu haben lange Hütten entwickelt, deren gerippte Wände aus geflochtenen Palmraffia-Matten bestehen, wobei der Giebel oft von einer Veranda flankiert wird. Im Batéké-Land sind einige Hütten ganz aus Stroh gebaut, wobei die Wände aus Elementen bestehen, die leicht demontiert werden können, wie z. B. geflochtene Strohplatten. Die Téké sind auch für ihre Dekorationskunst berühmt, die sich in ihren Korbmöbeln und in ihrer Kunst der bunt bemalten Holzbretter mit geometrischen Mustern, die die Wände der Hütten beleben, widerspiegelt.
Koloniale Periode
Die erste französische Siedlung entstand 1880. Das Gebiet wurde daraufhin in Konzessionen organisiert, um die Ausbeutung der Ressourcen zu fördern. Poto-Poto, heute ein Stadtteil von Brazzaville, wurde 1900 auf sumpfigem Gelände gegründet. Sehr schnell wollte die Kolonialverwaltung dem Gebiet ihren Stempel aufdrücken. Poto-Poto wurde daher nach einem schachbrettartigen Masterplan völlig neu konzipiert. Aus dieser Zeit sind noch einige Backsteinhütten mit viereckigen Blechdächern erhalten. Ein weiterer Ort, der Gegenstand eines großen Stadtentwicklungsplans wurde, war Pointe-Noire. In den 1920er Jahren entwickelte sich die Stadt zu einem Handels- und Wirtschaftszentrum, vor allem dank des Aufkommens der Eisenbahn. Die Kolonialverwaltung teilte die Stadt in eine "europäische Zone" und eine "einheimische Zone" ein. Mit dem Anstieg der Bevölkerung wuchs die Stadt radial, indem sie durch große Avenuen verbundene Ringe hinzufügte, deren geradliniges Aussehen an das Paris Haussmanns erinnern sollte. Die Aufteilung in rasterförmig angeordnete Blöcke und Parzellen ermöglicht es der Kolonialverwaltung, die "einheimischen Zonen" besser zu verwalten. Die räumliche und rassische Segregation lässt sich deutlich an der Art der Bauten ablesen, die in den "indigenen Zonen" prekär bleiben und meist aus Abfallmaterialien errichtet werden. In den "europäischen Zonen" hingegen ist alles kodifiziert und reglementiert (Proportionen, Fluchten, verwendete Materialien, Stile), und es wird großer Wert auf Grünflächen gelegt, die den städtischen Raum "auflockern". Dieses Muster findet man auch in Brazzaville, wo die älteste Kathedrale Zentralafrikas steht: die Cathédrale du Sacré-Cœur mit ihrer beeindruckenden Ziegelsteinsilhouette. Der Palais du Peuple mit seinen Arkaden, durchbrochenen Balustraden und Pilastern, die die Fassaden seiner symmetrischen Flügel schmücken, ist ein weiteres Beispiel für Kolonialarchitektur mit neoklassizistischen Anklängen. Erst in der Nachkriegszeit tauchten neue Stile auf. Die weiße, schlichte Villa des Direktors der Caisse Centrale d'Outre-Mer in Brazzaville mit ihrer Veranda auf Stelzen, deren Kurven an ein Passagierschiff erinnern, ist ein sehr schönes Beispiel für Art déco. Parallel dazu brachten viele Beamte aus dem Südwesten Frankreichs die architektonischen Traditionen ihrer Heimatregion mit. Zwischen Modernität und Rustikalität ist das Neobaskische mit seinem Fachwerk, den sehr steilen Dächern aus Ziegeln und den bunten Fensterläden sehr beliebt. Im Quartier du Clairon in Brazzaville sind die ehemaligen Offiziershäuser perfekte Zeugen dafür. Das schönste Beispiel für diese historisierende Moderne ist jedoch zweifellos der Bahnhof von Pointe-Noire. Er soll eine Kopie des Bahnhofs von Trouville sein! Sehen Sie sich seine Arkaden, den Uhrenturm und die hohen Giebel an. In dieser Zeit verwandelte sich Brazzaville-la-verte, wie die Stadt damals genannt wurde, in ein wahres architektonisches Laboratorium und erlebte die Entstehung einer erstaunlichen tropischen Moderne. Die Maisons Tropicales von Jean Prouvé sind berühmte Beispiele dafür. Diese in den Ateliers des Meisters in Nancy entworfenen Fertigbauten wurden wieder aufgebaut, insbesondere in der Avenue Paul Doumer, unweit der großen Post von Brazzaville. Obwohl sie im Laufe der Jahre verändert und beschädigt wurden, haben sie noch immer das, was sie in den 1950er Jahren so modern machte: wunderschöne Aluminiumkarosserieteile mit Lüftungsschlitzen und den berühmten Prouvé-Bullaugen, verstellbare Vordächer und Sonnenschutzelemente, Balkone und Veranden mit eleganten Geländern. Jean Prouvé war auch an einem anderen Vorzeigeprojekt der damaligen Zeit beteiligt: der Unité d'Habitation d'Air France, die von den Bewohnern aufgrund des roten Sandsteins, aus dem sie gebaut wurde, "l'immeuble rouge" (das rote Gebäude) genannt wurde. Das 1952 von vier Schülern Le Corbusiers entworfene Gebäude folgt mit seinen 140 m langen, von Brise-soleil und Lüftungsschächten unterbrochenen und von Dachterrassen überragten Gebäuden den großen Ideen des modernistischen Meisters. Die Möbel im Inneren waren von Jean Prouvé und Charlotte Perriand, einer der größten französischen Designerinnen, entworfen worden. Leider wurden viele ihrer Schätze während des Bürgerkriegs geplündert, als das Gebäude dem Militär als Hauptquartier diente. Henri Chomette, ein Architekt, der in vielen französischen Kolonien tätig war, baute das Gebäude der Société Générale und Henri-Jean Calsat stattete die Hauptstadt mit ihrem ersten allgemeinen Krankenhaus aus. Die beiden größten Architekten dieser modernistischen Erneuerung waren jedoch Roger Lelièvre, besser bekannt unter dem Namen Roger Erell (in Anlehnung an seine Initialen RL!), und Jean-Yves Normand. Roger Erell war eine große Persönlichkeit der Résistance und wurde von De Gaulle selbst ausgewählt, um in der Abteilung für öffentliche Arbeiten in Brazzaville zu arbeiten, das 1941 die Hauptstadt des Freien Frankreichs war. Sein Credo war einfach: alle Neuheiten der Moderne mit dem Potenzial lokaler Materialien und Stile zu verbinden, wie zum Beispiel dem malvenfarbenen Sandstein, der an den Ufern des Kongoflusses reichlich vorhanden war. Die Basilika Sainte-Anne mit ihrem großen Dach aus grün glasierten, schuppenartigen Ziegeln, die an eine Schlangenhaut erinnern, den großen Öffnungen ohne Buntglasfenster, die eine ständige Belüftung ermöglichen, und dem großen Gewölbe aus Mauerwerk, das einen Grundriss mit Schiff und drei Apsiden schützt, geht auf ihn zurück. Die Universität Marien-Ngouabi mit ihrer Fassade aus geometrischen Fensterrahmen, der Leuchtturm von Brazza und das Stade Félix Eboué wurden ebenfalls von Erell entworfen. Sein berühmtestes Werk ist jedoch die Case De Gaulle, die heutige Residenz des französischen Botschafters. Gedacht als "Durchgangscase für hohe Gäste", übernimmt es die Codes eines modernistischen Klassizismus, wie man ihn in Paris mit dem Palais de Chaillot sehen kann. Sandstein und Beton, Pilaster, Balustraden, die die Terrassen schützen, und Klaustrasen, die als Sonnenschutz dienen, beleben dieses schöne Gebäude. Roger Erell arbeitet mit Jean-Yves Normand zusammen, um die Stadtplanung von Brazzaville zu überdenken. Dabei wurden große Achsen verwendet, um die verschiedenen Bereiche der Stadt klar voneinander abzugrenzen. Die beiden Architekten interessierten sich besonders für die Avenue Foch, die sie mit imposanten Arkaden ausstatteten, um die Fußgänger vor Sonne und Regen zu schützen. Die Avenue schafft schöne Perspektiven auf das von Normand entworfene Rathaus. Seine beiden versetzt übereinander liegenden Fassaden sind mit Reihen von sieben Säulen geschmückt, die auf die sieben Künste verweisen. Seine breite Freitreppe mit schwarz-weißen Fliesen beeindruckt. Der Justizpalast ist ein weiteres seiner sehr schönen Bauwerke und ein Meisterwerk dieser klimatischen Architektur, die nichts dem Zufall überlässt, um sich perfekt an die Umgebung anzupassen: Anordnung der Bauwerke entsprechend der vorherrschenden Winde und der Sonneneinstrahlung, Säulengänge, die große Schattenbereiche schaffen, große Fenster mit beweglichen Trennwänden, um Luft und Licht zu modulieren, Möbel aus lokalem Holz. Ein Bezug zur lokalen Geschichte findet sich auch in seiner Kirche Notre-Dame-du Rosaire, deren Fassade das Modell der Ngongui, einer traditionellen Glocke aus dem Kongo, aufgreift.
Seit der Unabhängigkeit
Zur Feier seiner Unabhängigkeit errichtete das Land moderne Gebäude, in denen das damals vorherrschende Material Beton zum Einsatz kam. Auch alte Gebäude wurden ersetzt, wie z. B. der Bahnhof von Brazzaville. Eine Art, mit der kolonialen Vergangenheit endgültig zu brechen. Auch Kirchen verändern ihre Silhouette, wie die Eglise Saint-Christophe in Pointe-Noire mit ihren verputzten Blockwänden, die von Sichtblenden unterbrochen werden, und ihrem Metallgerüst, das ein Dach aus verzinktem Blech trägt, zeigt. Modernität und Nüchternheit sind vorherrschend. Wie viele seiner Nachbarn weckte auch die Republik Kongo Begehrlichkeiten und ausländisches Kapital, vor allem aus Russland und China, das zahlreiche Bauprojekte wie den Kongresspalast und die Verwaltungs- und Justizschule finanzierte. Sehr schnell erlebte das Land auch eine rasante Urbanisierung, die zu großen Wohnungsproblemen führte. Schätzungen zufolge leben 70% der Bevölkerung in Städten, davon 37% allein in der Gegend um Brazzaville. Ohne wirkliche Regelungen oder Bebauungspläne wächst die Hauptstadt auf anarchische Weise, wobei zahlreiche Viertel aus notdürftigen Selbstbauten entstehen. Manchmal werden Bauprogramme aufgelegt, aber ihre Umsetzung wird durch Kostenprobleme wie in den Vierteln Jacques Opangault oder Talangaï erschwert. Letzteres wurde zwar dank des 6.865 m langen Talangaï-Kintélé-Viadukts mit Schrägseilen erschlossen. Trotzdem startet das Land große Bauprojekte, um seinen wirtschaftlichen Wohlstand zu demonstrieren, insbesondere Hochhäuser, darunter der 106 m hohe Tour Nabemba und die im Oktober 2023 eingeweihten Tours Jumelles im Stadtteil Mpila, die mit ihren 135 m Höhe die Stadt überragen. Zu den Einschränkungen der Urbanisierung kommen auch die Probleme im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung hinzu. Um diesen Problemen zu begegnen, haben sich einige Architekten für nachhaltigere Bauten entschieden, ohne jedoch auf Modernität zu verzichten. Das Kongresszentrum von Kintélé ist ein gutes Beispiel dafür. Große Kolonnaden bieten Schutz vor den Elementen und öffnen gleichzeitig die Räume nach außen, die Fenster sind tief in die Wände eingelassen und durch Sichtblenden geschützt, Wasser ist überall in Form von Brunnen und Wasserfällen vorhanden, die wahre Inseln der Frische bieten, während die natürlichen Farben des Gebäudes dafür sorgen, dass es sich harmonisch in seine Umgebung einfügt, die nur wenig verändert wurde, da die Architekten versuchten, die Ausgrabungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Das Musée du Cercle Africain in Pointe-Noire hingegen ist ein gutes Beispiel dafür, was eine Sanierung leisten kann. Dem Art-déco-Gebäude aus dem Jahr 1947 wurden breite Terrassen sowie Bühnen- und Modulräume hinzugefügt. Weitere interessante Projekte wie der Büroturm von Africanews in Brazzaville sind zu erwarten. Der auf vier totemartigen Säulen stehende Turm soll ebenfalls ein doppeltes Holzdach und eine begrünte Dachterrasse haben, wobei überall das traditionelle Rautenmuster aufgegriffen wird, als Verbindung zu den Reichtümern des Landes. Fortsetzung folgt!